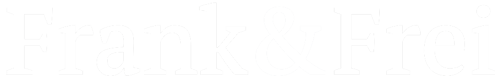Wenn der Konsument zum Kontosklaven wird
Viele gute Dinge sprechen aus Sicht der Neosozialisten für Bargeldrestriktionen oder sogar für eine bargeldlose Gesellschaft. Doch kein einziges Argument überzeugt wirklich. Der eigentliche Grund ist ein ganz anderer: Ohne Bares lassen sich bei Bedarf Strafzinsen auf Kosten der Sparer einfacher umsetzen.
Wenn Politiker unpopuläre Maßnahmen durchsetzen möchten, versuchen sie, dem ganzen einen positiven „Spin“ zu geben, also einen Dreh, damit das Unbeliebte zumindest besser klingt. Zu den mehrheitlich unbeliebten Themen gehören in Österreich und Deutschland mögliche Bargeldrestriktionen oder sogar Bargeldverbote. Derzeit werden in Deutschland noch rund 78 Prozent aller Zahlungsvorgänge im Einzelhandel bar abgewickelt. Also wird den Bürgern erzählt, in welch wunderbarer Welt sie leben könnten, wäre nur das „Schurkengeld“ endlich abgeschafft oder seine Verwendungsmöglichkeit eingeschränkt. Die Zahl der Banküberfälle ginge dann zurück, weil dort in einer bargeldlosen Zeit nichts mehr zu holen sei, das Zahlen an der Kasse könnte mit Karte oder Smartphone schneller und günstiger abgewickelt werden, Steuerhinterziehung würde eingedämmt und der Terrorismus finanziell ausgetrocknet.
Soweit die Märchenstunde. Keines dieser Argumente vermag wirklich zu überzeugen. Tatsächlich ist die Zahl der Banküberfälle in den vergangenen Jahren ohnehin drastisch gesunken. In Deutschland etwa kam es im Jahr 1993 zu 1624 Banküberfällen mit Raub oder räuberischer Erpressung. Im Jahr 2015 waren es genau achtmal weniger Fälle. Überwachungskameras, Alarmsysteme, DNA-Analysen und andere Sicherungsmaßnahmen zeigen Wirkung. Soweit die gute Seite. Allerdings gibt es auch eine Kehrseite: Abgesehen von der stark zunehmenden Cyberkriminalität haben es Räuber auf Juweliere abgesehen. Vor allem sehr teure Armbanduhren aus der Schweiz und Glashütte stellen mittlerweile fast schon eine Art Ersatzgeld dar. Die Zahl der Überfälle auf Juweliere lässt sich jedoch nicht mit Bargeldrestriktionen reduzieren, im Gegenteil.
Das Ende der Märchenstunde
Auch das Argument, das bargeldlose Zahlen am Point of Sale sei besonders effizient, ist mittlerweile widerlegt. Unlängst veröffentlichte die Deutsche Bundesbank eine Untersuchung zu den „Kosten der Barzahlung im Einzelhandel“. Die Untersuchung wurde gemeinsam mit dem EHI Retail Institute erarbeitet. Das Ergebnis muss nur diejenigen überraschen, die den Märchen der Bargeldgegner blind vertrauen. Tatsächlich ist bargeldloses Zahlen weder schneller noch günstiger als Cash-Transaktionen. „An der Ladenkasse ist die Bezahlung noch immer das schnellste und kostengünstigste Zahlungsmittel“, betonte jüngst Bundesbank-Vorstandsmitglied Johannes Beermann.
Im Durchschnitt dauert ein Bezahlvorgang mit Bargeld im deutschen Einzelhandel rund 22 Sekunden. Das sind der aktuellen Studie zufolge sieben Sekunden weniger als bei einer Kartenzahlung mit PIN-Eingabe. Besonders zeitaufwändig ist die Kartenzahlung mit Unterschrift. Dieser Vorgang dauert im Durchschnitt sogar rund 16 Sekunden länger als eine Cash-Transaktion, nämlich 38,6 Sekunden. Und auch das Argument, bargeldloses Zahlen sei kostengünstiger, gilt nicht generell. Bis zu einem Betrag von etwa 50 Euro sind Barzahlungen für den Handel günstiger. Erst bei höheren Beträgen erweisen sich Zahlungen mit der Girocard (frühere EC-Karte) als vorteilhaft.
Beim Blackout ist Cash fesch
In der Bundesbankstudie noch nicht berücksichtigt werden konnte die kontaktlose Zahlung mit dem Smartphone. Allerdings flossen entsprechende Simulationen in die Studie mit ein. Auch diese Art des Bezahlens ist nicht per se günstiger als Barzahlung. Außerdem funktioniert das bargeldlose Zahlen nur, wenn die Zahlungsterminals in Betrieb sind. Im Falle eines längeren Strom-Blackouts, wie im Februar in Teilen Berlins, heißt es dann wieder: Nur Cash ist fesch.
Ob ein Bargeldverbot die Steuerhinterziehung in großem Stil eindämmen kann, darf ebenfalls bezweifelt werden. Zwar würde in der Tat jedes Trinkgeld erfasst. Doch die millionenschweren Umsatzsteuer-Karussellgeschäfte von Land zu Land, die wirklich zu sehr hohen Steuerausfällen führen, kann man mit Bargeldrestriktionen nicht verhindern. Denn die funktionieren ohnehin nur bargeldlos durch Banküberweisungen. Und dass man dem Terrorismus mit weniger Bargeld wirklich begegnen kann, glaubt wohl keiner so recht. Es sei denn, es käme zu einem weltweiten Bargeldverbot, was wenig wahrscheinlich ist.
Mit anderen Worten: Die genannten Argumente sind größtenteils nur vorgeschoben. Die Abschaffung oder die deutliche Beschränkung von Bargeldtransaktionen dient einem ganz anderen Zweck. Damit ließen sich flächendeckend Negativzinsen einführen – auch für Sparer und Anleger mit geringen Rücklagen. Schon heute bekommt der Sparer für seine Einlagen kaum noch Zinsen. Manche Banken berechnen bei größeren Vermögen sogar Negativzinsen und bezeichnen diese als „Parkgebühr fürs Geld“. Der Kunde zahlt also dafür, dass die Bank sein Geld für ihn aufbewahrt.
Dauert die Wachstumsschwäche im Euroraum noch länger an und droht am Ende vielleicht sogar eine Rezession, so bleiben der Europäischen Zentralbank kaum noch nennenswerte Optionen. Wenn die Zinsen schon bei null Prozent sind, kann man sie nur in den negativen Bereich senken, um den Konsum zu stimulieren. In diesem Fall aber dürften wohl die meisten Bankkunden ihre Konten plündern und ihr Geld lieber zu Hause in einem vermeintlich oder tatsächlich sicheren Versteck aufbewahren. Das funktioniert aber nur, solange es noch Bargeld gibt. Denn ansonsten können die Bankkunden ihre Konten eben nicht plündern, weil Geld in physischer Form nicht mehr zur Verfügung steht. Ihre Guthaben erschienen nur in digitalisierter Form auf dem Computer-Monitor oder dem Smartphone-Display. In ihrem aktuellen Buch „Bitcoin & Co.“ machen die Finanzexperten Claus Vogt und Roland Leuschel auf die bemerkenswerte Tatsache aufmerksam, dass der Vorschlag, das Bargeld abzuschaffen, nicht von Kriminalisten stamme, sondern von US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern, die in diesem Zusammenhang explizit den Hinweis auf „negative Zinsen“ als Begründung nennen. Nicht nur in Berlin heißt es in solchen Fällen: „Nachtigall, ick hör dir trapsen.” Ein Bargeldverbot oder auch nur eine Einschränkung des Bargeldes würde der Einführung von Negativzinsen in Zeiten der Wachstumsschwäche Tür und Tor öffnen. Die Menschen könnten keine hohen Summen mehr abheben und wären gleichsam Kontosklaven ihrer Hausbank.
Europäischer Flickenteppich
Das – und nicht all die vorgeschobenen Argumente – ist der eigentliche Grund für den Kampf gegen das Bargeld. Während die Verantwortlichen in Brüssel hinter vorgehaltener Hand für eine EU-weite Barzahlungsgrenze von etwa 3000 bis 5000 Euro pro Transaktion eintreten, gleicht Europa in dieser Hinsicht derzeit noch einem Flickenteppich. Während ein Kunde in Deutschland oder Österreich nach wie vor auch größere Summen bar begleichen darf (allerdings müssen Händler bei Barzahlungen ab 10.000 Euro die Identität des Käufers prüfen, wodurch die Anonymität von Barzahlungen aufgehoben ist), liegt zum Beispiel die Höchstgrenze für Barzahlungen in Griechenland nach Angaben des Europäischen Verbraucherzentrums gerade einmal bei 500 Euro. Italien führte unter dem früheren Ministerpräsidenten und Goldman-Sachs-Berater Mario Monti zunächst eine Barzahlungshöchstgrenze von 1000 Euro ein. Nachdem die Italiener diesen Schwellenbetrag aber kreativ zu umgehen wussten, wurde die Barzahlungsgrenze auf 3000 Euro angehoben. In Spanien dürfen Ortsansässige nur bis 2500 Euro in bar bezahlen, in Portugal sind zwischen Verbrauchern und Händlern nur noch Cash-Transaktionen bis 1000 Euro möglich. Schließen Verbraucher untereinander Geschäfte ab, gibt es keine Beschränkungen. In Belgien beträgt das Barzahlungslimit 3000 Euro. Es gibt allerdings einen Gesetzesvorschlag, wonach diese Höchstgrenze auf 7500 Euro erhöht werden soll. In Schweden, dem EU-Vorreiter in Sachen Bargeldabschaffung, gibt es zwar kein Cash-Limit, dafür wird Bargeld aber in vielen Geschäften und Hotels regelrecht diskriminiert. Sogar den Espresso am Stockholmer Flughafen muss man mit Karte zahlen. Insgesamt haben aktuell 12 der 28 EU-Staaten eine Bargeldobergrenze eingeführt.
Mit der Forderung nach einer Bargeldabschaffung macht man sich allerdings weder in Österreich noch in Deutschland viele Freunde. Und deshalb wird dieses Thema derzeit offiziell kaum noch diskutiert, schließlich stehen die EU-Parlamentswahlen vor der Tür. Doch vom Tisch sind Bargeldeinschränkungen oder gar –verbote damit gewiss nicht. Im Gegenteil: Vor Kurzem erst sprach sich die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses im Europaparlament, die deutsche Abgeordnete Ingeborg Gräßle (CDU), explizit für eine Barzahlungsobergrenze aus. „5000 Euro sollten mehr als ausreichend sein“, sagte sie in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung.
Der Europaabgeordnete Sven Giegold (Grüne) hält die Umsetzung einer Bargeldgrenze in Deutschland für schwer durchsetzbar. Deshalb plädiert der ehemalige Frontmann von Attac für eine Meldepflicht für Barzahlungen bei Beträgen ab 10000 Euro, so die Big-Brother-Phantasien des grünen Europaabgeordneten.
Bargeld als Zweitwährung?
Dass es in manchen Ländern schwierig sein dürfte, Barzahlungsobergrenzen oder sogar Cash-Verbote umzusetzen, ist auch den Ökonomen des Internationalen Währungsfonds (IWF) klar. Sie schlugen Anfang des Jahres ernsthaft vor, Bargeld künftig wie eine Zweitwährung zu behandeln und Waren mit zwei unterschiedlichen Preisen auszuzeichnen – der günstigere Preis für Karten- oder Smartphone-Zahler, der höhere Preis für Barzahler.
Dahinter steckt ein perfider Plan: Angenommen, die Notenbanken beschließen einen Leitzins von minus drei Prozent. Sparer, die 1000 Euro auf ihrem Konto haben, verfügen also nach einem Jahr nur noch über ein Guthaben mit einer Kaufkraft von 970 Euro (die Preissteigerungsrate nicht berücksichtigt). Wer das Geld zuvor jedoch abhebt, hat nach einem Jahr immer noch 1000 Euro. Wenn Bargeld aber wie eine zweite Währung behandelt würde, wäre es möglich, es um drei Prozent abzuwerten. Und prompt zahlten auch die Bargeldanhänger drei Prozent „Strafzinsen“, wenn auch indirekt. Denn aufgrund der Abwertung läge die Kaufkraft von 1000 Euro Bargeld dann auch nur noch bei 970 Euro.
Ein zweiter Weg zur schleichenden Enteignung der Bürger ist das Projekt „Joghurt-Währung“. Ein wichtiges Instrument hierfür wäre die Einführung von Fedcoins, also Kryptowährungen, die von den Notenbanken emittiert werden. Das könnte schneller gehen, als mancher erwartet. Seit 2016 soll die Schwedische Notenbank (Riksbank) an der sogenannten e-Krona arbeiten. Noch in diesem Jahr könnten die Notenbanker mit der Umsetzung der staatlichen Digitalwährung beginnen. Das wäre ein weiterer Schritt hin zur schwedischen Cashless-Society. Zu deren Protagonisten gehört unter anderem die Journalistin und Notenbankerin Cecilia Skingsley, die überzeugt ist, Schweden werde innerhalb von drei bis fünf Jahren zur bargeldlosen Gesellschaft.
Das mag die Ideologen und Big-Brother-Apologeten erwartungsfroh stimmen, doch hat die Sache einen Haken, der gerade den Linken nicht gefallen dürfte. In einer bargeldlosen Gesellschaft werden Zahlungsvorgänge ausschließlich noch über Banken möglich sein. Für die privaten Geldinstitute könnte dadurch ein Transaktionsmonopol entstehen und zu sprunghaft steigenden Gebühren führen. Die staatliche Kryptowährung wäre in diesem Fall ein alternativer Zahlungsweg. Die e-Krona und andere staatliche „Kryptos“ können zum Beispiel auf Prepaid-Karten gespeichert und wie Prepaid-Kreditkarten am Point of Sale eingesetzt werden.
Auf dem Weg zur „Joghurt-Währung“
Das ist aber nur ein Grund (und vermutlich nicht einmal der wichtigste), weshalb immer mehr Notenbanker und Ökonomen staatliche „Kryptos“ plötzlich so gut finden. Denn von der Notenbank ausgegebenes Digitalgeld ist bestens für die Einführung der erwähnten „Joghurt-Währung“ geeignet. Heißt im Klartext: Die Digitalwährung wird mit einem „Haltbarkeitsdatum“ ausgestattet. Wird es überschritten, verliert das Geld automatisch an Wert. Theoretisch könnte man dies bis zur völligen Wertlosigkeit des E-Geldes fortsetzen, technisch wäre das überhaupt kein Problem. Die Bürger würden auf diese Weise dazu erzogen, ihr Geld auszugeben und die Konjunktur zu beleben. Das Szenario könnte in Krisenzeiten wie 2008/2009 etwa wie folgt aussehen: Die Notenbanken führen einen Zinssatz von minus drei Prozent ein. Dieser Strafzins wird von den vorhandenen Kontoguthaben abgezogen. Und das auf einem Chip gespeicherte Geld verliert nach Ablauf des „Haltbarkeitsdatums“ drei Prozent an Wert. Da ist es dann egal, ob man sein Geld auf dem Konto oder auf der Prepaid-Karte hat.
Keine Frage, weite Teile der einflussreichen Finanz- und Politik-Elite wollen lieber heute als morgen Bargeldrestriktionen als Vorstufe zu einem Bargeldverbot einführen. Ob das in Europa gelingt, hängt nicht zuletzt von den Mehrheitsverhältnissen im neuen Europaparlament ab. Immerhin gibt es hier und da noch den einen oder anderen Hoffnungsschimmer. Während jeder Schwede nach einer Statistik des World Payment Reports im vergangenen Jahr im Schnitt über 461 digitale Zahlungen tätigte und das Land damit erstmals vor den USA lag, steigt in Europa der Bargeldumlauf. Er lag in der Eurozone im Jahr 2000 noch bei etwa fünf Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts. Bis 2016 hatte sich dieser Anteil auf fast elf Prozent mehr als verdoppelt. An alle Politiker, Banker, Finanzpolizisten und Bürgerkontrolleure: Bisweilen leben Totgesagte tatsächlich länger.