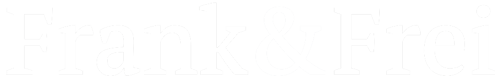Endstation Hoffnung
Das Beste, das kurz vor der stattfindenden Wahl im Mai über die Union gesagt werden kann, ist, dass sich vieles ändern wird. Multiple Krisen haben dem Gemeinschaftsmodell seine Grenzen aufgezeigt. Das Problem ist die EU selbst. Ohne echte Reformen wird es eng für das Projekt.
So wie bisher geht es in Brüssel und Straßburg nicht weiter. Darüber sind sich Volk und Volksvertreter mehr oder minder einig. Das Hangeln von Krisengipfel zu Krisengipfel, die Politik der kleinen Grüppchen in endlosen Sitzungen, all die intransparenten, undemokratischen Konferenzen ohne konkreten Output sind Sinnbild für eine überforderte Union, die ihrer Probleme nicht Herr wird. Der Staatenverbund leistet nicht das, was die Bürger erwarten, ihre Repräsentanten verstricken sich lieber im Klein-Klein.
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zerbricht sich seit Herbst 2018 den Kopf über die Zeitumstellung, auch der zuständige Verkehrsausschuss im Europaparlament hat sich schließlich der überaus bedeutungsschweren Sache angenommen. Jüngst hat sich das oberste rechtsprechende Organ der EU, angespornt von der Arbeiterkammer und einem Atheisten, mit der bisherigen österreichischen Karfreitagsregelung beschäftigt und ist zu dem heldenhaften Schluss gekommen, dass eine unzulässige religiöse Diskriminierung vorliege. Eine Änderung musste schleunigst her. Ganz nach dem Motto: Wichtiges zuerst.
Dort, wo die Union wirklich gefragt ist, scheitert sie. Nicht zuletzt aufgrund des deutlichen Versagens in sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen, beim effektiven Schutz der Außengrenzen oder bei der zwingenden Rückführung von Migranten in ihre Herkunftsländer, verliert die EU immer mehr an Bürgervertrauen und Glaubwürdigkeit. Auf vielen anderen Gebieten, wo etwas mehr Subsidiarität die Lösung wäre, mischt sich die Union pausenlos ein und verliert sich auf überregulierten Irrwegen. Ein dringender Reformbedarf des zentralbürokratischen Apparats steht außer Zweifel. Die Idee von einst ist längst an einem Punkt angelegt, wo es wenig zu gewinnen gibt, zu weit hat es sich von den einstigen Entstehungsbedingungen entfernt. Sowohl Beobachter als auch Akteure geben zu bedenken, dass es eine existentielle Neuordnung braucht, will das Projekt überleben.
Stabilität sieht anders aus
Es wäre gut, wenn zumindest der Brexit, der sich mittlerweile zu einer ziemlichen Katastrophe entwickelt hat, die EU-Eliten grundsätzlich zum Nachdenken veranlasst hätte. Genau das ist bisher nicht geschehen. Das Desaster rund um Großbritanniens Austritt zeigt exemplarisch, was alles schiefläuft. Seit dem Votum weiß man, dass niemand gezwungen ist, Mitglied der Union zu sein. Die Europäische Union hat ihren Mythos der Unwiderstehlichkeit eingebüßt. Obwohl die Abstimmung urdemokratisch war, verständigte sich die EU wie ein schlechter Verlierer darauf, aktionistischen Druck auf London auszuüben, statt den nötigen Respekt vor der Entscheidung aufzubringen. Die Härte, mit der das Führungspersonal gegen London auftritt, um ein Exempel zu statuieren, schädigt jedoch auch andere und kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Wähler entschieden hat und nicht Boris Johnson oder mazedonische Hacker. Bis heute begreift sich die Europäische Union dennoch als Selbstzweck, nicht als Idee, von der es zu überzeugen gilt und nimmt damit in Kauf, noch mehr an Strahlkraft einzubüßen.

Es steht jedenfalls viel auf dem Spiel, umso aufgeregter gestaltet sich der Europawahlkampf. Die Erregung ist groß, die Stimmung aufgeladen. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Zumal zeitgleich in Belgien die Parlamentswahl ansteht, wo die Koalition über dem UN-Migrationspakt zerplatzt ist. Im Herbst 2019 werden außerdem die Griechen zur Urne gebeten, wo die Konservativen die Regierungspartei Syriza überholen könnten. Die Stimmungslage in Großbritannien ist bekannt, wie es wirklich weitergeht eher nicht. In Frankreich stemmen sich die Gelbwesten gegen ihren europhilen Präsidenten. Die Koalition in Italien zeigt sich wenig friedlich, die Lega unter Salvini gewinnt an Zuspruch. Die Osteuropäer wehren sich vehement gegen den Brüsseler Zeigefinger und treten für ihre Souveränität ein.
Die Vorzeichen in Europa stehen auf Veränderung. Dagegen kann auch der gespielte Optimismus von Merkel bis Macron nichts ausrichten, die Achse Berlin-Paris bröckelt ohnehin weg. Die neue CDU-Chefin, Annegret Kramp-Karrenbauer, und Emmanuel Macron haben grundlegend verschiedene Sichtweisen auf die Europäische Union. Dazu kommt, dass Angela Merkel seit dem Wechsel an der CDU-Spitze nur mehr die Rolle einer beleidigten Noch-Kanzlerin spielt, die von der neuen Profilschärfung ihrer Partei nichts hält und sich stattdessen ganztags damit die Zeit vertreibt, die internationale Ordnung der Welt zu retten. Sie nutzt die letzten Gelegenheiten, um an ihrem Vermächtnis zu zimmern. Diese allein für die Geschichtsbücher gestaltete Selbststilisierung erweist sich in Anbetracht ihres fatalen politischen Erbes allerdings als ein Sisyphosakt. Um ihren französischen Freund Macron steht es nicht viel besser. Die Anhimmelung war einmal. Die Realität ist nüchterner: Frankreichs Präsident kann doch nicht übers Wasser laufen.
Macrons Mitteilungsbedürfnis
Apropos Macron. Knapp drei Monate vor der Wahl machte der Staatspräsident via Gastbeitrag in den führenden Tageszeitungen der EU-Mitgliedsländer medienwirksam Werbung für sich und seine europäische Idee. Fast wie zu seinen besten Zeiten, die beim Anblick seiner Beliebtheitswerte nostalgisch anmuten. Bereits 2017 forderte der Franzose dringend neue Impulse für die EU, getan hat sich nichts. Die selbstzufriedene Brüsseler Behörde sah sich wenig bemüßigt, Überzeugungsarbeit zu leisten. Diesmal wiederholte Macron sein Mantra, alarmistisch im Ton, fast fiebrig und abseits der Alltagsrealität.

Als glühender Zentralist schlug er unter anderem die Schaffung neuer politischer Plattformen, etwa eine Behörde für den Schutz der Demokratie, vor, auf denen die Staats- und Regierungschefs alle wichtigen Entscheidungen unter sich treffen. Zu den unzähligen Baustellen, welche die Union bedrängen, fällt Macron nicht mehr ein, als noch mehr EU-Institutionen zu gründen und neue Zuständigkeiten nach Brüssel zu verlagern. Er möchte die Ablehnung vieler Bürger gegenüber dem Superstaat mit noch mehr Zentralismus bekämpfen. Die Kritik an der EU ist anscheinend immer noch nicht bis durch die Mauern des Élysée-Palasts gedrungen. Macron hat es diesmal ohne Gelbwesten in die Schlagzeilen geschafft. Allemal ein kleiner Erfolg.
Was auf Macrons Agenda nicht fehlte, war der erschöpfte Hinweis auf das sich ausbreitende Schreckgespenst des Nationalismus. Das kennt man schon. Auch die düsteren Wolken des Nationalismus will Macron mit zentral organisierter Bürokratie vertreiben. Als große Gefahr neben den Nationalisten identifizierte Macron Hackerangriffe und Manipulationsversuche antieuropäischer Mächte, die Wahlen beeinflussen würden. Nicht Politiker sind folglich für Wahlergebnisse verantwortlich, sondern die dunkle Seite der Macht, die mit raffinierter virtueller Desinformation, mit Brainhacking, die demokratischen Freiheitsrechte gefährdet. Obendrein nutzte Macron die mediale Bühne gleich dafür, sich verbal an die Spitze der Klimaretter zu stellen, kommt immer gut, sich als Teil einer planetarischen Schöpfungsmission zu verstehen, unabhängig davon, ob die Forderungen umsetzbar sind oder nicht. Zum einen lässt sich damit ein erhebendes Gefühl provozieren, zum anderen von den Widrigkeiten in der französischen Heimat ablenken.
Ganz und gar unromantisch
Die Kritik an der Union nimmt konstant zu und verhärtet sich, weil sich am Status quo nichts ändert. Stattdessen siegt der Kleingeist, das Demokratiedefizit der Institutionen ist ein Dauerbrenner. Das Heldenhafte der Gründerväter, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg trotz aller Uneinigkeiten auf ein Friedensprojekt einigten, ist verblasst, nur mehr Teil einer warmen Erinnerung. Zu offensichtlich ist die schiefe Einschätzung, die Union sei primär eine wirtschaftliche Vereinigung mit dem Binnenmarkt als integratives Herzstück. Von Beginn an war die Europäische Union ein politisches Unterfangen, die Wirtschaft das Hilfsmittel, um Politik zu machen. Und Politik wurde im Namen der Europäischen Union genügend gemacht.
Der idyllische Gedankenschluss, dass sich die ehemaligen Kriegsparteien ursprünglich einem absolut selbstlosen Friedensprojekt widmeten, verrückt die Realität dann doch ein wenig. Dass die europäischen Staaten auch heute keine Kriege gegeneinander führen würden, schmälert die Verdienste der EU zwar nicht, macht aber verständlich, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Die Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich ebbte nach dem Krieg nicht von heute auf morgen ab. Man einigte sich, auf nationale Dominanzansprüche zu verzichten, Deutschland war kurz nach Kriegsende willig bereit, jegliches Hegemoniebestreben von sich zu weisen und sich mit Schuldgefühlen zu plagen. Die Montanunion war für Frankreich ein willkommenes Instrument, um ein kräftiger werdendes Deutschland durch eine supranationale Institution zu binden und zu kontrollieren.
Deutschland wurde an die Kandare genommen, zu groß war die Angst vor einem Wiedererstarken. Es ging nicht nur um Ritterlichkeit und Wohlwollen, sondern auch um Kontrolle und Interessen. Ebenso wenig war die Währungsunion ein Kind gesamtharmonischer Zustände. Deutschland zahlte damit den Preis für die Wiedervereinigung, die zwei Jahre nach dem Mauerfall besiegelt wurde. Frankreich wusste um die Stärke der D-Mark, wollte die Währungsunion, Deutschland die Wiedervereinigung und keinesfalls den Frieden gefährden. Frankreich hatte ein Druckmittel, Deutschland keine Alternative. So verdrängte der Euro die D-Mark. Gänzlich unromantisch.
Vom Kurs abgekommen
Mit dem Euro als einheitliche Währung sollte alles besser werden. Aber anstatt den Kontinent auf unabsehbare Zeit zu einen, erschütterte der Euro die Union. Souveräne Staaten mit unterschiedlich entwickelten Volkswirtschaften unter ein Währungsdach zu stecken, sollte nur noch mehr Probleme schaffen. Kritiker warnten früh vor angeblichen Konstruktions- und Folgefehlern. Brüssel hoffte auf das Beste, stattdessen brach 2008 Lehman Brothers zusammen und die schlechten Nachrichten aus Griechenland ließen nicht allzu lange auf sich warten.
Spanien, Portugal, Irland, Zypern gesellten sich in den Klub der Wankenden. Es folgten Rettungspakete auf Basis eines Vertragsbruchs. Der Übergang von der Stabilitätsgemeinschaft zur Transferunion wurde Realität. Bis heute spielt EZB-Chef Mario Draghi mit billigem Geld und Niedrigzinsen auf Zeit. Den Werdegang des Euro als Erfolgsgeschichte zu verkaufen, vermag selbst ein geübter Euro-Euphoriker nicht, ohne dabei rot zu werden. Der viel zitierte Politiker und Publizist Ralf Dahrendorf prophezeite schon 1995 ganz nüchtern: „Die Währungsunion ist ein großer Irrtum, ein abenteuerliches, waghalsiges und verfehltes Ziel, das Europa nicht eint, sondern spaltet.“
Im Jahr 2015 eröffnete sich eine weitere Front, angezettelt von Angela Merkel, unterstützt von ihrem europäischen Freundeskreis. Ihr Tun und Nichtstun wird noch lange nachwirken. Sie hat ihre Partei, Deutschland und ganz Europa ins Chaos gestürzt und ein weiteres Mal entscheidend dazu beigetragen, das System EU an den Rand zu drängen. Die Union stärkte ihr artig den Rücken und stellte sich dabei dümmer, als sie ist. Brüssel nahm den Kontrollverlust in Kauf. Und all die Konsequenzen, die den Kontinent heute beschäftigen.
Gegen den Gattungsfeind
Der Stand der Europäischen Union kurz vor der Wahl ist kein leichter. Die Euphorie der bedingungslosen EU-Befürworter hält sich in Grenzen. Man weiß, wie es um das Projekt bestellt ist, wenn wegfallende Roaminggebühren oder Rechte für Entschädigungen bei Flugverspätungen als Pro-EU-Argumente in die Diskussion eingebracht werden. Alle Trends und Umfragen deuten in die Richtung, dass beide Großparteien verlieren werden, die eine mehr, die andere weniger. Ziemlich sicher wird die absolute Mehrheit der großen Koalition dahin sein. Die europakritischen Stimmen werden wohl zunehmen, unabhängig davon, ob die Rund-um-die-Uhr-Empörten immer lauter kreischen.

Wie verhalten sich die österreichischen Parteien im europapolitischen Spannungsfeld? Die meisten sind sich irgendwie einig, dass Reformen notwendig sind. Gut, die Neos, die sich selbst in der meinungslosen Mitte verorten, bekunden dann doch lieber ihre Nähe zu den Grünen, mit einer gemeinsamen Wahlwerbung für die Vereinigten Staaten von Europa. Wie erfolgsträchtig dieser Reformwunsch sein wird, liegt auf der Hand. Die Sozialdemokraten, seit einer gefühlten Ewigkeit auf Tauchstation, begnügen sich damit, die Wahlkampfbühne für den altbekannten Kampf gegen ihren Gattungsfeind zu nutzen. Manches wird sich niemals ändern. Das SPÖ-Programm für die Europawahl ist damit schnell erklärt: Alles, was nach rechter Ideologie riecht, wird bekämpft. Das muss genügen.
Alle roten Hoffnungen ruhen auf Pamela Rendi-Wagner, der Parteichefin, die sich den Tarnmantel umgeworfen hat, um unsichtbar zu bleiben, und Andreas Schieder, der nach der Demontage als Klubobmann und dem Scheitern am Weg zum Bürgermeisteramt vorsorglich nach Brüssel geschickt wird. Wie man weiß, fürchtet sich der SPÖ-Spitzenkandidat vor nichts mehr als vor den Rechten, welche die EU gefährden, in die Krise stürzen, zerstören, in die Katastrophe führen, in den Untergang treiben würden, wie er Mitte März in einem wahlwerbenden Gastkommentar formulierte. Dagegen wirkt sogar Macrons Europarede sachlich. Ob Schieders Plan, die Union als sozialistische Menschengemeinschaft gegen die Rechtsnationalisten zu etablieren, aufgehen wird, darüber lässt sich wohl streiten. Dass die Zwischentöne im Wahlkampf schwinden, gehört zur Natur der Sache, dass man selbst immer richtigliegt und die anderen immer falsch ebenso, aber dass man beim Themensetting EU nichts Kreativeres aufs Tapet bringt als den Kampf gegen rechts, zeugt von Tragik und Selbstaufgabe.
Ende der Märchenstunde
Die Nervosität unter den EU-Funktionären wird zum Wahltermin hin nicht weniger werden. Im Gegenteil. Vor die Notwendigkeit gestellt, glaubwürdig Reformwillen zu bekunden, agiert die Union seltsam hilflos. Wie auch immer, eines ist wohl wahrscheinlich: Die Karten werden neu gemischt. Das Beste, das kurz vor der Wahl über die Union gesagt werden kann, ist, dass sich vieles ändern wird. Zu lange hat sich Brüssel mit moralischer Arroganz gegen jegliche Kritik immunisiert. Es wäre also an der Zeit, dem Wähler nicht nur Märchen zu erzählen, sondern stückchenweise von der Wirklichkeit zu berichten, auch wenn sie die eigenen Schwächen offenlegt. Daran führt kein Weg vorbei. Wer Empörung zum Argument macht und so viel Angst vor Änderung hat, dass er davor warnen muss, hat jetzt schon verloren.

Dieser Text von Jürgen Pock ist in der aktuellen Ausgabe von Frank&Frei – Magazin für Politik, Wirtschaft und Lebensstil erschienen. Sie ist ab 8.April bei Frank&Frei erhältlich.